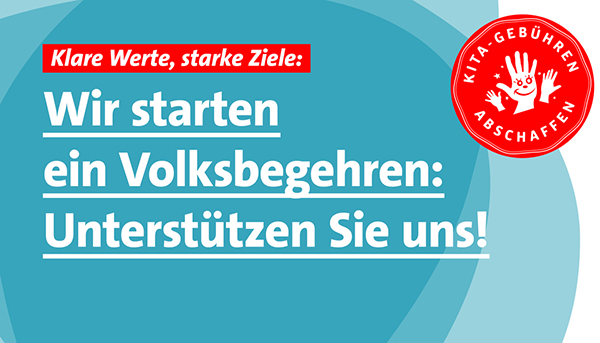150 Jahre SPD - „…ohne Frieden ist alles nichts!“

Bilder und Texte wurden der Pubilkation "Reden zur Jubiläumsfeier 150 Jahre SPD - 14.Juni 2013 Steinhalle Emmendingen - Wolfram Wette & Dietrich Elchlepp" entnommen.
Hier geht es zu Teil 2 - "150 Jahre SPD – Freiheit und Gerechtigkeit" von Dietrich Elchlepp, MdEP a.D.
Teil 1
„…ohne Frieden ist alles nichts!“

In ruhigen Zeiten gerät leicht aus dem Blick, dass der Kampf der Sozialdemokratie für Demokratie und soziale Gerechtigkeit schon immer eine ganz wesentliche Voraussetzung hatte und noch heute hat: die Bewahrung des Friedens.
„Frieden“, sagte Willy Brandt einmal, „ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts!“
Diesen trefflichen Satz habe ich als Titel meines Festvortrages gewählt.
Vor 150 Jahren: Wie alles begann.
In den 1860er Jahren, als unsere Partei gegründet wurde, war es in erster Linie der Nationalismus, der in ganz Europa für Spannungen sorgte und Unfrieden stiftete. Hinzu kam als ein neues Phänomen der Militarismus. Er zog in mehreren Ländern gleichzeitig herauf, entwickelte sich aber in Preußen-Deutschland mit besonderer Vehemenz, indem er hier das ganze politische und gesellschaftliche Leben durchdrang. Der Militarismus beschwor eine ständige Kriegsgefahr herauf und er machte „den Staat zu einer großen Kriegsmaschine“.
August Bebel und Wilhelm Liebknecht gegen den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71
Zur Zeit des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 saßen unter den 297 Abgeordneten des Reichstags des Norddeutschen Bundes lediglich 6 Sozialdemokraten. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck benötigte damals einen Krieg mit Frankreich, um mit seiner Politik von „Blut und Eisen“ einen geeinten deutschen Staat zu bauen.

Die Sozialdemokraten sahen sich vor eine große Herausforderung gestellt: Sollten sie in die allgemeine, nationalistisch geprägte Kriegsbegeisterung einstimmen? Sollten sie im Parlament die von der Regierung geforderten Kriegskredite bewilligen, also dem Krieg ihren Segen geben? Oder sollten sie gegen den Strom zu schwimmen und als erklärte Gegner von dynastischen Kriegen friedenspolitisch Flagge zeigen?
Die Abgeordneten August Bebel und Wilhelm Liebknecht hatten 1870 den Mut, trotz der nationalistischen Hochstimmung im Parlament und in der Bevölkerung ihre Zustimmung zum Krieg gegen den französischen Nachbarn zu verweigern. Über die aggressive Stimmung, die ihnen daraufhin im Reichstag des Norddeutschen Bundes entgegen schlug, berichtete Liebknecht:
„Wir zwei wurden mit unverhohlenem Hass und Abscheu betrachtet. Wir galten als Landesverräter in des Wortes verwegenster Bedeutung.“
Hier nahm die Diffamierung der Sozialdemokraten als „vaterlandslose Gesellen“ ihren Anfang.
Aber es blieb nicht bei verbalen Diffamierungen. Bismarck drängte die Justiz, Bebel und Liebknecht auch strafrechtlich zu verfolgen. Die beiden Mandatsträger wurden verhaftet und wegen Landesverrats angeklagt. Als sich eine Begünstigung des äußeren Feindes trotz aller Anstrengungen nicht belegen ließ, schwenkte die preußische Regierung um und warf den beiden Parlamentariern „Vorbereitung zum Hochverrat“ vor, weil sie angeblich auf den Sturz des bestehenden Staates hinarbeiteten. Schließlich wurden Bebel und Liebknecht zu zweijähriger Festungshaft verurteilt, die sie in der Folgezeit auch absitzen mussten. Der Prozess machte die beiden Parlamentarier reichsweit bekannt. Viele Menschen in ganz Deutschland zollten ihnen Respekt. Damit begann der Aufstieg Bebels zum populären und höchst angesehenen SPD-Parteiführer, was sich in ehrenden Bezeichnungen wie „Gegenkaiser“ oder „Arbeiterkaiser“ widerspiegelte.
Bebel und Liebknecht setzten im Reichstag des Norddeutschen Bundes nicht nur ein Zeichen gegen den Krieg. Ganz entgegen dem Zeitgeist traten sie auch für eine deutsch-französische Verständigung ein, wozu es wiederum beträchtlichen Mutes bedurfte. Im Namen des Selbstbestimmungsrechts der Völker protestierten sie gegen die Absicht der Regierung, Elsaß-Lothringen zu annektieren. Bebel forderte „Frieden mit der französischen Nation, unter Verzichtleistung auf jede Annexion“.
Aber die preußisch-deutschen Machtpolitiker dachten in anderen Kategorien. Sie benötigten, von 1870 aus gesehen, noch ein Dreivierteljahrhundert und noch zwei mörderische Weltkriege, bis ihnen allmählich dämmerte, dass Bebel und Liebknecht vielleicht doch den besseren politischen Weg gewiesen hatten: den Weg zu einem befriedeten Europa.
Wilhelm Liebknecht nutzte die Bühne des Leipziger Gerichts, um einer breiteren politischen Öffentlichkeit die langfristigen friedenspolitischen Vorstellungen der Sozialdemokraten darzulegen. So wurde im Leipziger Hochverratsprozess für viele Zeitgenossen erstmals erkennbar, dass es in Deutschland überhaupt so etwas wie ein politisches Antiprogramm zum reaktionären und aggressiven Militärstaat gab. Die Arbeiter der europäischen Länder, sagte Wilhelm Liebknecht im Jahre 1872, wollten
„in Frieden miteinander leben“, statt „durch das sogenannte Nationalgefühl sich gegeneinander hetzen zu lassen“ und sich „gegenseitig für Interessen, die nicht die ihrigen sind, die Gurgeln abzuschneiden“.
Daher erstrebe die Internationalen Arbeiter-Assoziation (IAA) einen „allgemeinen freien Völkerbund“, der aber nicht als eine Sammlung von Monarchien verstanden werden sollte, sondern als ein Bündnis von demokratischen Staaten. So also sah sozialdemokratische Friedens- und Europapolitik schon vor mehr als 140 Jahren aus!
Erster Weltkrieg, Weimar, NS-Zeit, frühe Bundesrepublik
Über die Zeitspanne, die den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, die Nazi-Zeit, und die frühen Jahre der Bundesrepublik umfasst, kann ich hier nur in wenigen – aber hoffentlich treffenden – Stichworten reden.
In den anderthalb Jahrzehnten vor dem Beginn des Weltkrieges 1914 setzte sich die SPD als einzige Partei in Deutschland für eine konsequente Politik der Kriegsverhütung ein. Den Höhepunkt dieser Bestrebungen bildete der Internationale Friedenskongress in Basel im November 1912, vor knapp mehr als 100 Jahren. Im Ersten Weltkrieg bewilligte die SPD-Reichstagsfraktion die von der Regierung geforderten Kriegskredite. Ob diese Entscheidung richtig und falsch war, ist bis heute Gegenstand heftiger Kontroversen. Wichtig ist, das Folgende zu wissen: Die kaiserliche Regierung konnte die Zustimmung der SPD-Mehrheit nur mit der Lüge erreichen, das Deutsche Reich befände sich in einem Verteidigungskrieg. Diese Kriegslüge löste die entsprechenden patriotischen Reflexe aus. Über die Kriegsfrage kam es dann, wie bekannt, zur Spaltung der SPD, die erst 1920 überwunden werden konnte.
In den Jahren der Weimarer Republik unterstützte die SPD Stresemanns Politik der Verständigung mit den Siegermächten des Weltkrieges 1914-18 und bekämpfte die auf neue Gewaltlösungen drängende nationalistische Rechte. Im Zweiten Weltkrieg gab es die SPD nicht mehr. Das Nazi-Regime hatte sie schon 1933 verboten. Ihr Führungspersonal ging in die Emigration oder wurde politisch verfolgt. Viele Sozialdemokraten wurden ermordet.
Die ab 1950 von Adenauer betriebene Politik der Wiederbewaffnung Westdeutschlands wurde von der SPD zunächst abgelehnt. Ebenso der Eintritt in die Nato. Erst als diese Politik nicht mehr zu verhindern war, nahm die SPD Einfluss auf die gesetzgeberische Ausgestaltung der politischen Kontrolle der Bundeswehr.
Die Friedenspolitik Willy Brandts
Nach diesen Stichworten springe ich in die Zeit der sozial-liberalen Koalition 1969-82. Im Jahre 1969 wurde der Sozialdemokrat Gustav W. Heinemann, der zuvor zu den entschiedensten Gegnern der Wiederbewaffnung gehört hatte, zum Bundespräsidenten gewählt. Er setzte sogleich friedenspolitische Zeichen, die den Konservativen im Lande ein Dorn im Auge und ein Stein des Anstoßes waren. In seiner Antrittsrede vor dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in Bonn am 1. Juli 1969 sagte Heinemann: „Ich sehe als erstes die Verpflichtung, dem Frieden zu dienen. Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem der Mann sich zu bewähren habe, wie meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den Schulbänken lernte, sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir uns alle zu bewähren haben. Hinter dem Frieden gibt es keine Existenz mehr.“

Wenige Monate später, am 28. September 1969, gewannen SPD und FDP erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die Bundestagswahlen. Willy Brandt wurde Bundeskanzler und Walter Scheel (FDP) Außenminister. In der Folgezeit setzte diese Regierung ihre Entspannungs- und Ostpolitik ins Werk. Mit ihrer Politik der Verständigung erfüllte sie das Diktum Gustav Heinemanns vom Frieden als Ernstfall mit Leben. Jene Menschen in Deutschland, die in den frühen 1970er Jahren noch immer in der Gedankenwelt militärischer Machtpolitik lebten, sie konnten nun etwas Neues lernen: Dass mit einer Politik der Verständigung und des Ausgleichs weitreichendere Ziele erreicht werden konnten als mit einer Politik des Wettrüstens, der militärischen Drohung und der atomaren Abschreckung.
Wer von uns schon in den 1970er Jahren in der SPD politisch aktiv war, für den werden die aufregenden Wahlkämpfe jener Zeit unvergesslich sein. Damals, 1969, als die sozial-liberale Bundesregierung ins Amt kam, war der Frieden in der Welt und in Mitteleuropa keineswegs sicher. Das lag an der internationalen Konstellation des Kalten Krieges, der Ost-West-Konfronta-tion, dem Misstrauen der führenden Politiker der beiden Blöcke und an der gefährlichen Hochrüstung. Die größte Gefahr aber bestand darin, dass der Kalte Krieg irgendwann doch in einen heißen Krieg mit Atomwaffen umschlagen könnte. In der Kuba-Krise von 1962 wäre das fast passiert. Auch später blieb der Krieg aus Versehen, geboren aus dem permanenten Misstrauen, eine reale Gefahr. So hat beispielsweise der couragierte Oberstleutnant der sowjetischen Luftwaffe Stanislaw J. Petrow, auf dessen Bildschirm anfliegende Raketen erschienen, im Jahre 1983 einen Atomkrieg verhindert. Er entschloss sich nämlich, nicht, wie es eigentlich vorgeschrieben war, den „roten Knopf“ zu drücken. Für seine großartige Tat wurde er später mit mehreren Friedenspreisen ausgezeichnet.
In den Jahren 1969-1974, als der Sozialdemokrat Willy Brandt deutscher Bundeskanzler war, hatte das Thema Frieden Hochkonjunktur wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Denn die Regierung Brandt/Scheel stellte dieses Thema in das Zentrum ihrer Politik. Wie viele andere Studentinnen und Studenten der 1968er Zeit auch, bin ich damals - vor nunmehr 42 Jahren - wegen der Ost- und Entspannungspolitik der SPD beigetreten. Ich hatte 6 Jahre Bundeswehr-Erfahrung hinter mir, hatte eine Dissertation über „Kriegstheorien deutscher Sozialisten“ von Karl Marx bis Rosa Luxemburg geschrieben und gehörte 1971 zu den Mitbegründern der bundesdeutschen Friedens- und Konfliktforschung. Außerdem hatte ich Carl Friedrich von Weizsäckers Abhandlung über „Kriegsfolgen und Kriegsverhütung“ gelesen.
Die zentrale Erkenntnis, die Weizsäckers Wissenschaftler-Team damals aus der Analyse eines möglichen Atomkrieges zog, lautete: Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Daraus leitete es die zwingende Schlussfolgerung ab, der sich fortan keine politische Partei mehr verschließen konnte: Zur Friedensbewahrung gibt es keine Alternative!
Aus demselben Grund sagte Willy Brandt in seinem Vortrag anlässlich der Verleihung des Friedens-Nobelpreises in Oslo am 11. Dezember 1971:
„Ich begreife eine Politik für den Frieden als wahre Realpolitik dieser Epoche.“
Damit drehte er rhetorisch geschickt ein altes Credo der deutschen Nationalisten um, die seit dem 19. Jahrhundert immer wieder polemisiert hatten, militärische Machtpolitik sei die einzige Realpolitik und die Suche nach politischem Frieden sei letztlich eine Idee von Spinnern und naiven Weltverbesserern.
Mein eigentlicher Erfolg war, mit dazu beigetragen zu haben,
dass in der Welt, in der wir leben, der Name unseres Landes
und der Begriff des Friedens wieder in einem Atemzug genannt
werden können.
Willy Brandt 1988
Das von Egon Bahr entwickelte Konzept „Wandel durch Annäherung“ war seinerzeit alles andere als ein Selbstläufer. Es wurde von der konservativen Opposition, die aus den Schützengräben des Kalten Krieges nicht herausfand, auf das Heftigste bekämpft. CDU und CSU warfen der sozial-liberalen Bundesregierung damals vor, sie mache eine Unsicherheitspolitik und betreibe den Ausverkauf deutscher Interessen. Aber das Gegenteil war der Fall, und die Mehrheit der bundesdeutschen Bevölkerung, der die Erinnerung an die Weltkriege noch „in den Knochen“ steckte, begriff das und honorierte es. Die sozialliberale Koalition konnte sich 1972 behaupten. Die SPD erhielt 45,8 Prozent der Stimmen. Das war der größte Wahlerfolg für die SPD überhaupt in ihrer langen Geschichte. Errungen durch eine überzeugende Politik des Friedens!
Das Nein Schröders zum Irak-Krieg
Erinnern wir uns bei dieser Gelegenheit auch an die Bundestagswahlen vom 22. September 2002, drei Jahrzehnte nach dem großen Wahlsieg von 1972. Die Wahlen von 2002 konnten von der SPD – trotz miserabler Ergebnisse in den Meinungsumfragen im Vorfeld – mit der äußerst knappen Mehrheit von nur 6000 Stimmen doch noch gewonnen werden, weil Kanzler Gerhard Schröder sein Nein zum Irak-Krieg der USA verkündet hatte. Das traf die Antikriegsstimmung in großen Teilen der Bevölkerung und gewiss in der ganzen SPD. Basis und Führung befanden sich jetzt in vollem Gleichklang. Nimmt man die beiden Wahlerfolge von 1974 und 2002 zusammen, so kann man wohl mit einem gewissen Recht sagen: Mit ihrer Friedenspolitik hat die SPD nicht nur viel Gutes für die Menschen in unserem Lande getan. Sie hat mit ihr auch Wahlen gewonnen.
Nach der Zäsur von 1989/90
Wir erlebten 1989/90 eine große historische Zäsur: Das Ende des Kalten Krieges und des Ost-West-Konflikts, die friedliche Revolution in der DDR, ihre Angliederung an die Bundesrepublik – genannt Wiedervereinigung –, den Zusammenbruch der Sowjetunion, später die Aufnahme einer ganzen Reihe ost- und südosteuropäischer Länder in die Europäische Union; und wir erlebten den Eintritt unseres Landes in eine globalisierte Welt mit ihren marktradikalen Verwerfungen, das Entstehen eines mächtigen, kaum kon- trollierten Finanzkapitals, das die Frage nach der bändigenden Funktion des Staates neu aufwirft.
Auf dem Gebiet der Friedens- und Sicherheitspolitik kam es ebenfalls zu weitreichenden Veränderungen. Die von 1949 bis 1989 praktizierte – aber auch durch die Machtverhältnisse erzwungene – Kultur der militärischen Zurückhaltung Deutschlands fand ihr Ende. Sie wurde schrittweise abgelöst durch eine aktive internationale Politik, die das militärische Instrument wieder in den Dienst der Außenpolitik stellte; wenn auch nicht, wie früher, zu Zwecken der Eroberung, sondern zur internationalen Krisenbewältigung.
Kritiker dieser Entwicklung sprechen von einer schleichenden Militarisierung der Außenpolitik. Gelegentlich wird sogar erwogen, das Militär zur Rohstoffsicherung einzusetzen. Ein Bundespräsident, der darüber öffentlich redete, musste bekanntlich zurücktreten. Wir müssen uns an dieser Stelle selbstkritisch fragen: Wo sind die Proteste der SPD gegen solche Vorstellungen geblieben?
Kosovo-Krieg 1999
Tatsächlich ist es so, dass die SPD die neue Außenpolitik nicht selbst gestaltet hat, sondern ihr hinterher gelaufen ist. Sozialdemokraten und Grüne verstanden sich zu Anfang der 1990er Jahre noch ganz selbstverständlich als Verfechter einer Friedenspolitik. Als dann die Bürgerkriege in Jugoslawien ausbrachen, kam es in der SPD und in der Partei Bündnis 90/Die Grünen seit der Mitte der 1990er Jahre zu einer schweren Zerrreißprobe: Sollte die bisherige Außenpolitik der militärischen Zurückhaltung auch angesichts der Menschenrechtsverletzungen im Kosovo beibehalten werden? Oder sollte Deutschland – zusammen mit anderen europäischen Staaten – militärisch eingreifen? Schließlich fanden sich Mehrheiten in der SPD und bei den Grünen, die zu der Entscheidung gelangten, dass in dieser schwierigen Lage die pazifistische Tradition der alten Bundesrepublik nicht mehr aufrechterhalten Tradition der alten Bundesrepublik nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Als SPD und Grüne dann 1998 die Regierung übernahmen, gab es kein Zurück mehr. Kaum im Amt, exekutierte die neue Regierung die Politik ihrer Vorgängerin. Sie führte das Land 1999 in einen Krieg, der kein Verteidigungskrieg war. Erstmals seit 1945 führten deutsche Soldaten wieder Kampfeinsätze außerhalb der Grenzen des eigenen Landes und des Bündnisses.
Gerechtfertigt wurde dieser Krieg als eine „humanitäre Intervention“. Angesichts der gewaltsamen Vertreibung der Kosovo-Bevölkerung durch die Serben beschwor Außenminister Joschka Fischer zwei Glaubenssätze: „Ich habe nicht nur gelernt: Nie wieder Krieg, sondern auch: Nie wieder Auschwitz.“ Im Bundestag sahen sich die Abgeordneten erheblichem, ja erpresserischem Druck ausgesetzt, der Regierungspolitik zu folgen. Anders als bei dem Golfkrieg der USA 1991/92 protestierte die irritierte deutsche Bevölkerung diesmal nicht. Sie nahm den Krieg hin, wahrscheinlich, weil das vorgetragene Argument des Menschenrechtsschutzes weithin überzeugte.
Der Kosovokrieg war die Geburtsstunde des sogenannten Menschenrechtsbellizismus. Damit ist die Idee gemeint, dass bei schweren Menschenrechtsverletzungen militärisches Einschreiten geboten ist. Dieses Konzept wurde in einer Resolution der UN-Generalversammlung 2005 unter dem Titel „Schutzverantwortung“ (englisch: Responsibility to Protect, R2P) von fast allen Staaten der Erde anerkannt und von der UNO als völkerrechtlich verbindlich erklärt.
Anders als zur Zeit des Kosovo-Krieges vertritt die SPD heute die Position, dass eine solche – militärisch instrumentierte – Schutzverantwortung nur mit der Zustimmung des Sicherheitsrates der UNO übernommen werden darf.
Europa
Schon im 19. Jahrhundert haben sich deutsche Sozialdemokraten nicht nur für eine deutsch-französische Verständigung eingesetzt, sondern auch dafür, den Frieden gesamteuropäisch zu organisieren. Bei den Konservativen dauerte es noch rund ein Jahrhundert länger, bis auch sie für das politische Projekt eines geeinten Europa gewonnen werden konnten. Durchzusetzen war es nur mit den Konservativen, nicht gegen sie.
Heute versteht sich Europa als eine Friedensmacht. Kriegsverhütung nach innen ist ihr als ein Strukturprinzip eingewoben. Für diese Leistung erhielt die EU im Jahre 2012 in Oslo den Friedensnobelpreis. Mit Recht, wie ich finde, auch wenn es an der europäischen Außen-, Militär- und Waffenexportpolitik Vieles zu kritisieren gibt.
Das Projekt der zivilen Konfliktbearbeitung
Zur Zeit der rot-grünen Bundesregierung (1998-2005) und der sich anschließenden Großen Koalition (2005-2009) fand die Idee einer zivilen, also nicht-militärischen Konfliktbearbeitung Eingang in die deutsche Regierungspolitik, was in der Öffentlichkeit viel zu wenig wahrgenommen wurde. Federführend waren dabei die sozialdemokratischen Politiker Frank-Walter Steinmeier (Außenminister) und Gernot Erler (Staatsminister im Auswärtigen Amt). 2004 verabschiedete die Bundesregierung einen anspruchsvollen Aktionsplan mit dem Titel „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“. Auch wurde ein – mehrere Bundesministerien umfassender – „Ressortkreis zivile Krisenprävention“ gegründet. Leider sind diese friedenspolitischen Neuansätze bis heute ein „unscheinbares Nischenprojekt deutscher Außenpolitik“ geblieben. Stattdessen bedient sich die schwarz-gelbe Regierung wieder der traditionellen Praktiken der Außenpolitik, wovon das Schlagwort „Armee im Einsatz“ Zeugnis ablegt. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte hat die SPD jedes erdenkliche Recht, auf dem Gebiet der zivilen Konfliktbearbeitung eigene Akzente zu setzen. Dazu gehört es auch, die skandalöse Rüstungsexporte einzuschränken, den geheimnisvollen Bundessicherheitsrat abzuschaffen und die Waffenexporte unter parlamentarische Kontrolle zu stellen.
Besser noch wäre es, dieses „Export des Todes“, um ein Wort von Willy Brandt zu benutzen, ganz einzustellen.
Schluss
Anders als früher sehen die meisten Menschen in unserem Lande heute Frieden als einen zentralen Wert an. Etwa vier Fünftel der Bundesbürger stehen zum Beispiel dem Afghanistan-Krieg skeptisch bis ablehnend gegenüber.
Die Deutschen sind „gebrannte Schafe“. Sie wollen keine militärischen Helden mehr sein. Sie haben gelernt, dass Kriege kein Naturereignis und auch kein Gottesgericht sind, sondern ein verbrecherisches Menschenwerk. Gleichzeitig haben sie gelernt, dass Frieden möglich ist und dass er durch gute Politik organisiert werden kann. Diesen Wandel im Denken der Menschen maßgeblich mitgestaltet zu haben, ist vielleicht das größte Verdienst der SPD auf diesem Feld der Politik. Darauf können wir stolz sein.
Das in der Vergangenheit Geleistete verpflichtet aber auch. Wir sollten uns immer wieder auf das Diktum von Willy Brandt besinnen, das meine Ausführungen wie ein roter Faden durchzogen hat: „Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“ Unser Kanzlerkandidat Peer Steinbrück kündigte kürzlich in einer Grundsatzrede zur Außenpolitik an, wieder eine „aktive Friedenspolitik“ betreiben zu wollen. Darin möchten wir ihn mit Nachdruck bestärken.
Wolfram Wette
Waldkircher Erklärung gegen Waffenexporte


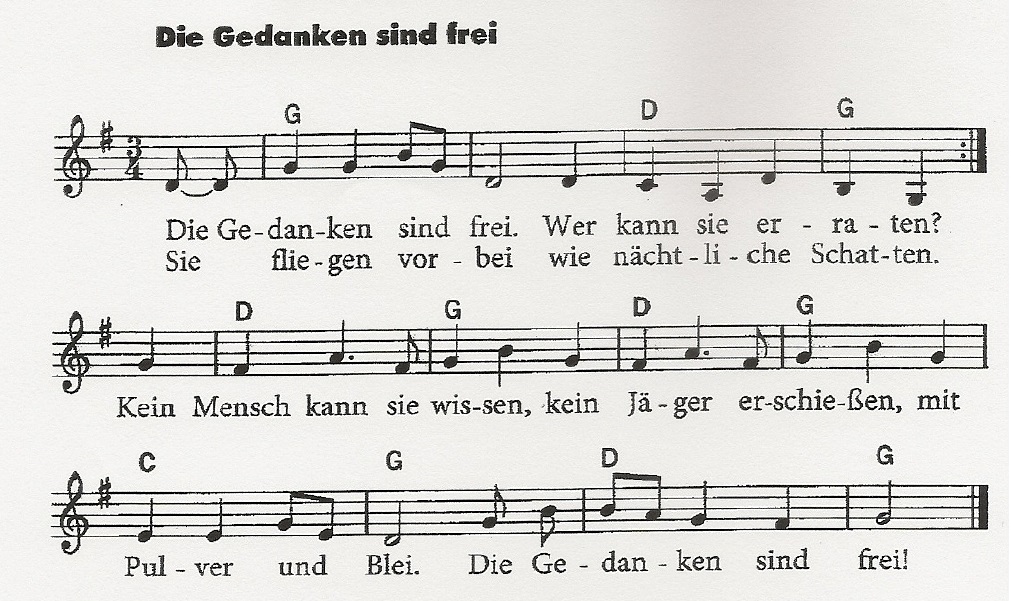
Hier geht es zu Teil 2 - "150 Jahre SPD – Freiheit und Gerechtigkeit" von Dietrich Elchlepp, MdEP a.D.
Termine
27.04.2024, 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Torwand schießen mit Marko Radovanovic und Wunschleiter
Ort: Schneckenbrunnen, Theodor-Ludwig-Straße, Emmendingen
30.04.2024, 07:30 Uhr
Brezeln für Europa
Ort: Denzlingen, Bahnhof
02.05.2024, 10:00 Uhr - 11:00 Uhr
Immer am 2-ten
Ort: Emotion, Landvogtei Emmendingen
03.05.2024, 19:00 Uhr
SPD-Frühlingsempfang mit René Repasi, MdEP und Vivien Costanzo
Ort: Kornhalle, Marktplatz 6, 79346 Endingen